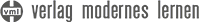- Bücher ▼
- - Bücher-Shop
- - Katalogbestellung
- - Buch des Monats
- - Neuerscheinungen 2025
- - Neuerscheinungen 2024
- - Unsere 50 beliebtesten Bücher
- - Informationen zum Programm 2024
- Zeitschriften ▼
- - Unsere Zeitschriften
- - praxis ergotherapie ▼
- - Beschreibung
- - Aktuelle Ausgabe
- - Abo-Bestellung
- - Abo-Kündigung
- - Fortbildungen
- - Anzeigen / Termine
- - Redaktion
- - Archiv
- - Anzeigenschluss-Termine
- - Praxis der Psychomotorik ▼
- - Beschreibung
- - Aktuelle Ausgabe
- - Abo-Bestellung
- - Abo-Kündigung
- - Einzelheft-Bestellung
- - Fortbildungen
- - Anzeigen / Termine
- - Archiv
- - Redaktion
- - Anzeigenschluss-Termine
- - Sprachförderung und Sprachtherapie ▼
- - Beschreibung
- - Aktuelle Ausgabe
- - Abo-Bestellung
- - Abo-Kündigung
- - Einzelheft-Bestellung
- - Anzeigen / Termine
- - Redaktion
- - Archiv
- - Anzeigenschluss-Termine
- - Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung ▼
- - Beschreibung
- - Aktuelle Ausgabe
- - Abo-Bestellung
- - Abo-Kündigung
- - Einzelheft-Bestellung
- - Anzeigen / Termine
- - Online-Anzeigen
- - Archiv
- - Anzeigenschluss-Termine
- - Redaktion
- - Probeabo
- - Media-Daten / AGB
- - Literaturverzeichnisse
- - Autorenverzeichnis
- - Stellenmarkt
Aktuelle Ausgabe
Heft 2/2025
| Laura Avemarie, Claudia Becker, Christian Müller, Mabu Aghaei, Swantje Marks, Nora Eisinger Inklusive Sprachbildung mit mehrsprachigen digitalen Bilderbüchern – Konzeptioneller Rahmen und pädagogisch-didaktische Leitlinien für das Vorlesen mit tauben, schwerhörigen und hörenden Kindern Mit dialogischem Lesen können Eltern und pädagogische Fachkräfte die kindliche Sprachentwicklung maßgeblich unterstützen. In einer von Digitalisierung geprägten Welt bieten mehrsprachige digitale Bilderbücher sprachförderliche Potenziale, die bislang noch selten genutzt werden (López-Escribano et al. 2021; Shamir et al. 2012). Sie ermöglichen nicht nur den Zugang zu Geschichten und Sachtexten in unterschiedlichen Sprachen, sondern bieten auch multimodale Möglichkeiten, die das Vorlesen und Lesenlernen unterstützen. Die digitalen Bilderbücher des BMBF-Projekts ReaDi (Reading Digital: Inklusive Sprachbildung mit mehrsprachigen digitalen Bilderbüchern in Laut- und Gebärdensprachen; Förderkennzeichen 01JM2205A/B) bieten deshalb verschiedene Lautsprachen sowie die Deutsche Gebärdensprache (DGS) zur Auswahl und beinhalten Fragen und Impulse zur Anregung von Gesprächen während des Vorlesens, die auf die heterogenen Bedürfnisse von tauben, schwerhörigen und hörenden Kindern abgestimmt sind. Somit eignen sie sich auch für den Einsatz in inklusiven Bildungssettings. Außerdem sind sie mit Trainings zum Vorlesen (in mehrsprachigen Kontexten und bei Verzögerungen im Erstspracherwerb) basierend auf Tutorials für Eltern und pädagogische Fachkräfte verbunden. In diesem Artikel werden der konzeptionelle Rahmen für pädagogisch-didaktische Leitlinien zum Vorlesen sowie die Trainings vorgestellt. Am Beispiel eines von 16 Bilderbüchern werden verschiedene Elemente aufgezeigt, die die Sprachbildung beim Vorlesen unterstützen können. | |
| Elisabeth Weiglin, Sandra Gogol, Barbara Hänel-Faulhaber Sprachförderung und Sprachtherapie in Gebärdensprache In diesem Artikel werden die interdisziplinären Ansätze zur gebärdensprachlichen Sprachförderung und Sprachtherapie in Deutschland vorgestellt und durch praxisnahe Beispiele veranschaulicht. Zunächst wird die Bedeutung von Hausgebärdensprachkursen mit Tauben Fachkräften für die Kommunikation und Sprachförderung beleuchtet. Im Anschluss werden Möglichkeiten für eine bimodale sprachtherapeutische Intervention skizziert und therapeutische Ansätze zur gezielten Unterstützung der Gebärdensprache beispielhaft vorgestellt. Schließlich wird der Aus- und Fortbildungsbedarf von Tauben Fachkräften im Bereich der Sprachtherapie hervorgehoben. |  |
| Karolin Schäfer, Elena Pützer Förderung lautsprachlicher Kompetenzen von Kindern mit Hörbehinderung: Wissenschaftliche Grundlagen und praxiserprobte Ansätze Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über Auswirkungen von Hörbehinderung auf die lautsprachliche Entwicklung und führt wissenschaftlich fundierte Ansätze zur Förderung sowie praxiserprobte Methoden auf. Dabei liegt der Fokus auf der Anwendbarkeit in Frühförderung, Schule und therapeutischen Kontexten. | |
| Chantal Weber, Daniel Priv.-Doz.Dr. Holzinger diaLOG – Ein Programm zur Schulung von responsivem Interaktionsverhalten und alltagsintegrierter Kommunikationsförderung für Betreuende tauber Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung Basierend auf den Methoden der Wissensvermittlung, videobasierter Selbstreflexion, der kollegialen Intervision gefilmter Interaktionen und der Weiterentwicklung der eigenen kommunikationsförderlichen Haltung und Fertigkeiten, z. B. im indirekten Einsatz von Kommunikationsförderstrategien in der Alltagskommunikation, steht das Prinzip der Responsivität im Mittelpunkt des assessmentbasierten Förderprogramms diaLOG. Die Lebensgeschichte einer tauben Person mit Mehrfachbeeinträchtigung zu verstehen und sie in ihrem Entwicklungsstand genau da abzuholen, wo sie steht, ihr die führende Rolle im Gespräch zu überlassen, mit der eigenen aktiven Kommunikation abzuwarten und behutsam auf Signale oder Kommunikationsinitiativen zu reagieren – darin liegt der Schlüssel für die Entwicklung von Vertrauen und Beziehung als Grundlage für die Entwicklung von Kommunikationsinitiative, Sprache und letzlich umfassendes weiteres Lernen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung funktionaler Alltagskommunikation, d. h. der zielgerichteten zwischenmenschlichen Kommunikation, da diese sozial-pragmatischen Fähigkeiten wiederum eine der Hauptgrundlagen für eine gesunde emotionale Entwicklung und für das psychische Wohlbefinden sowie auch ein Mittel für den Erwerb adaptiver und sozialer Kompetenzen darstellt (Fellinger et al. 2012). Nicht nur taube Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung, sondern auch taubblinde Menschen und hörende, nicht (ausreichend) lautsprachkompente Personen mit dem Bedarf an Unterstützter Kommunikation profitieren von den Methoden und Ansätzen des Programms diaLOG. | 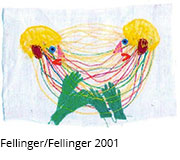 |
| Annabelle Fischer, Laura Spiegel, Sophie Heilig, Lisa Lipp, Laura Prof.in Dr. Avemarie Diagnostik lautsprachlicher Kompetenzen bei Kindern mit Hörbehinderung Die Diagnostik lautsprachlicher Kompetenzen bei Kindern mit Hörbehinderung unterliegt verschiedenen Herausforderungen. Um dennoch basierend auf existierenden standardisierten und normierten Testverfahren zuverlässige Testergebnisse gewinnen zu können, müssen verschiedene Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Testgütekriterien und zur Herstellung fairer Testbedingungen im diagnostischen Prozess berücksichtigt werden. Diese sind Gegenstand des vorliegenden Beitrags 1. Eingegangen wird dabei auf Maßnahmen zur Sicherung fachspezifischer Kompetenzen, Möglichkeiten zur Erfassung relevanten Vorwissens über das Kind, Optionen zur Gestaltung eines für Kinder mit Hörbehinderung angemessenen Testsettings, Kriterien zur Auswahl passgenauer Testverfahren, sowie die Beachtung von Besonderheiten in der Testdurchführung und -auswertung. |  |