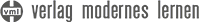Sabine Greinert, Sabrina Engelmaier, Sabrina Engelmaier, Sabrina Engelmaier
So-Move – Bewegte Sonntage für Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Familien
Obwohl schon seit Jahren mit der UN-Behindertenrechtskonvention eine inklusive Bildung gefordert wird und auch Nationale Aktionspläne darauf abzielen, Barrieren zu beseitigen und die gleichwertige Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben fordern, gibt es noch immer zu wenige Freizeitangebote, die inklusiv auch Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung stehen. Der Aktionskreis Motopädagogik Österreich hat mit seinen „So-Moves-Bewegte Sonntage“ ein inklusives Freizeitangebot entwickelt, das in diesem Fachartikel präsentiert wird. Zudem wird der Bewegte Sonntag zum Thema „Auf die Rollen – fertig – los! Fahren mit Rollbrettern“ als Praxisbeispiel vorgestellt.
|  |
|
Akoélé Sistagan Biam
Sozialraumorientierte Psychomotorik als Praxismethode der kommunalen Präventionsketten
In der psychomotorischen Entwicklungsförderung geht es u.a. um die Gesundheit und Bildung von Kindern und Jugendlichen. 2023 wurde im Rahmen der kommunalen Präventionsketten eine Gesundheitswoche in dem Kölner Sozialraum Ostheim/Neubrück organisiert, die in der Planung und Gestaltung psychomotorisch begleitet werden konnte.
Seit der Pandemie 2020 gewinnen die Initiativen zur Gesundheitsförderung an Bedeutung und Gewicht. In diversen Gremien in den Stadtteilen Ostheim und Neubrück, wie Arbeitskreisen und Stadtteilkonferenzen, wurde die Gesundheitsförderung und wie sie an Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien spielerisch herangetragen werden kann, zu einem zunehmend wichtigen Thema.
Um die Thematik zu veranschaulichen, werden in diesem Fachartikel neben den Begriffsbeschreibungen die sozialraumorientierte Psychomotorik (Kuhlenkamp, 2023) als eine Praxismethode der kommunalen Präventionsketten erläutert und ein konkretes Projekt während der o.g. Gesundheitswoche vorgestellt, gefolgt von einer Schilderung, wie in dem Sozialraum Ostheim/Neubrück für die Nachhaltigkeit der Angebote weitergearbeitet wird, als Ausblick.
| |
|
Birgit Sagstetter
Entschleunigung durch Bewegung
Psychomotorik als achtsames Bewegungsangebot für Kinder im Elememntarbereich
Die Autorin bietet seit Jahren gruppenübergreifend psychomotorische, inklusive Bewegungsangebote in der Kita an. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt und daher sehr begehrt. Häufig erhält sie Kinder zugeordnet mit dem Auslesekriterium, diese seien überdreht und überaktiv; es täte ihnen gut, sich im Turnraum auszutoben. In den Psychomotorikstunden erhalten die Kinder zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten den passenden Ort und Rahmen, um angestauten Druck, Überforderung und nicht zuletzt Stress abzubauen – mithin zu entschleunigen.
|  |
|
Judith Sägesser Wyss, Joséphine Schwery Klingele
Mehr als nur Schreiben: Wie gezielte Förderung das Selbstkonzept stärkt!
Die Stärkung eines positiven Selbstkonzepts ist ein zentrales Ziel der Förderung und Therapie im Bereich der Psychomotorik und damit auch in der Grafomotorik. Dieser Fachartikel gibt Einblick in Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit einer inklusiven Förderintervention zur Unterstützung der Grafomotorik in heterogenen ersten und zweiten Klassen und legt dabei den Fokus auf das grafomotorische Selbstkonzept der Kinder. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass durch ein gemeinsames Lernen im Klassenverband, kombiniert mit individualisierten Lernangeboten und der Reflexion individueller Fortschritte, Kinder mehr Vertrauen in ihre grafomotorischen Kompetenzen entwickeln.
| |
|
Lucia Maier Diatara, Olivia Gasser-Haas, Pierre-Carl Link
Körper – Beziehung – Verstehen
Mentalisierungsbasierte Psychomotoriktherapie in Ausbildung und Praxis
Ziel dieses Beitrags ist es, die Bedeutung einer mentalisierungsbasierten Psychomotoriktherapie (mPMT) als integratives Modell der Psychomotoriktherapie herauszustellen. Die Haltung der mPMT verknüpft verstehende und erklärende Zugänge in der Psychomotoriktherapie und schafft Impulse für die Gestaltung therapeutischer Beziehungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie diese Haltung nicht nur als unmittelbarer Wirkfaktor im Hier und Jetzt, sondern auch als Lern- und Modellbeziehung für soziales, emotionales, motorisches und sensorisches Lernen wirksam werden kann.
| |
|
Andrea Erkert
Hurra! Heute ist Waldtag
Spielerisch den Wald entdecken und erleben
Der Wald bietet viele Möglichkeiten, in Bewegung zu sein, kreativ zu werden oder zur Ruhe zu kommen. So können sich Kinder spielerisch Wissen über die Natur aneignen, ihren Wortschatz erweitern und weitere Fähigkeiten entwickeln. Dieser Artikel stellt acht Praxisbeispiele vor, die bei einem Waldtag der Kita einfach umgesetzt werden können.
|  |
|
Hanno Bröcker
Die Rolle der Psychomotorik in der klinisch–psychiatrischen Bewegungstherapie
Einführung in Theorie und Praxis
Die klinische Bewegungstherapie stellt einen etablierten Baustein in der stationären Behandlung von psychischen Erkrankungen dar. Die Psychomotorik hat einen festen Platz in diesem vielschichtigen und abwechslungsreichen Arbeitsfeld. Dieser Beitrag beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Grundzügen der Bewegungstherapie in der Erwachsenenpsychiatrie. In einem zweiten Teil werden bewährte Therapieverfahren kurz erläutert. Das Thema wird abgerundet durch eine Konzeptdarstellung für das Medium Tischtennis.
|  |
|
Ingrid Kollak
Mobilität erhalten
Bewegungstherapie als ein wichtiger und bisher noch nicht ausgeschöpfter Bestandteil der Behandlung von Adipositas
Mit körperlicher Bewegung werden oft Aktivitäten, wie Jogging, Cross-Training, Bauch-Beine-Po-Gymnastik usw. assoziiert. Das ist – nicht nur im Kontext von Adipositas – zu kurz gedacht. Zudem sind diese Betätigungen oft nicht gelenkschonend, ermüdend und tragen wenig zur Stärkung des Körperbewusstseins und der Gesundheitskompetenz bei. Dieser Fachartikel unterbreitet das Angebot, anders über körperliche Bewegung nachzudenken, und spricht ein dickes Lob auf die Mobilität aus. Denn sie bildet die Grundlage für eigene Entscheidungen und selbstständiges Handeln.
|  |